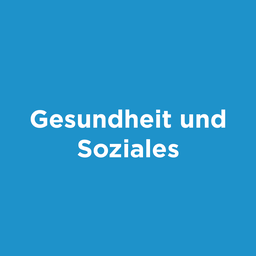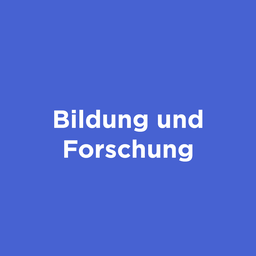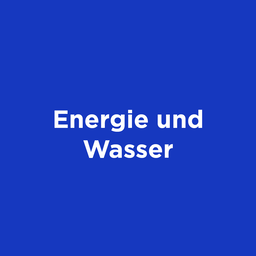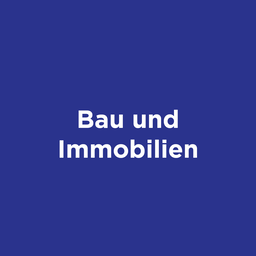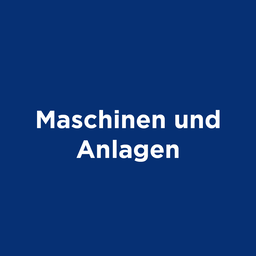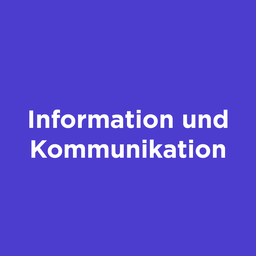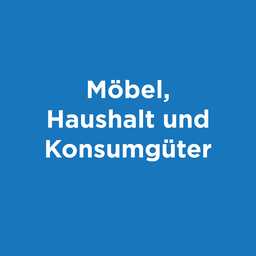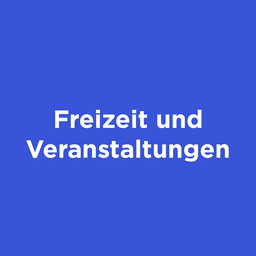Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen (außer den Gewinnern des Unternehmenspreises in den letzten drei Jahren) können sich weiterhin bewerben. Damit bleibt der Wettbewerb offen für alle Unternehmen.
Daneben findet eine umfassende, durch KI-unterstützte Recherche über das Internet öffentlich verfügbarer Nachhaltigkeitsdaten statt, wie sie in Nachhaltigkeitsberichten, Erklärungen zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder auf Unternehmenswebseiten mittlerweile von vielen Unternehmen publiziert werden. Gewinner der vergangenen drei Jahre finden in der Recherche für den DNP keine Berücksichtigung. Die Prozesse werden wissenschaftlich begleitet; die Qualitätssicherung wird händisch vorgenommen. Mit diesem Ansatz zielt der DNP auf eine skalierbare, transparente Datengrundlage.
Der Recherchepartner score4more hat sich auf das Erstellen differenzierter Nachhaltigkeitsprofile von Unternehmen und deren Bewertung spezialisiert. Das Berliner Start-up stellt seit 2023 die digitale Architektur für die Recherche über alle Sektoren und Branchen und die daraus hervorgehenden Unternehmensprofile zur Verfügung. Unternehmen jeder Größe können kostenfrei ihre Profile erstellen und so diese Plattform zur Bewerbung um den DNP nutzen.